Emissionsfrei in die Zukunft. Kosten? Strategie?
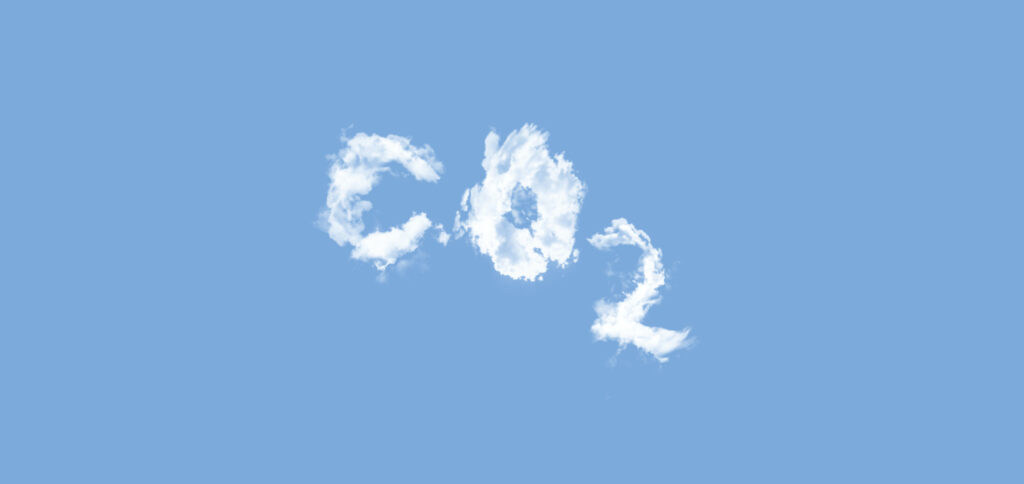
Die alte Bundesregierung hat sich im Rahmen des „Klimaschutzprogramms 2030“ auf eine CO2-Bepreisung für fossile Brennstoffe festgelegt. Diese gilt seit 2021 und steigt in einem fixierten Rahmen bis 2025 jährlich an. Welche Kosten kommen damit auf Brauereien und Mälzereien zu? Die Autoren Matthias Kern und Georg Schu, Ingenieurbüro für Energie- und Umwelttechnik, zeigen Strategien zur Reduktion der Kosten auf.
Bepreisung für fossile Brennstoffe
Energieintensive Unternehmen wie Brauereien und Mälzereien sind unmittelbar von der CO2-Bepreisung betroffen. Für die Betriebe ist es essentiell, die anfallenden Mehrkosten der kommenden Jahre zu kennen und Lösungswege aufgezeigt zu bekommen, wie sie diese Kosten, bei gleichzeitiger Verbesserung der eigenen Umweltbilanz, reduzieren können.
Entwicklung der CO2-Kosten
Pro Tonne CO2-Ausstoß waren von Unternehmen im Jahr 2021 25 EUR zu bezahlen. Das ergab bei der Nutzung von Erdgas unter Berücksichtigung des spezifischen Emissionsfaktors in etwa 0,5 ct/kWh.
Eine Brauerei mit einem jährlichen Brennstoffverbrauch von beispielsweise 5 Mio kWh wurde folglich mit Mehrkosten von etwa 25 000 EUR belastet. Bei Verwendung von leichtem Heizöl (mit höherem spez. Emissionsfaktor) hätten sich rund 33 000 EUR ergeben. Die CO2-Bepreisung steigt aber jährlich an. Für 2022 liegt der Preis bereits bei 30 EUR/t, im Jahr 2025 werden 55 EUR/t erreicht.
Im genannten Beispiel lägen die Mehrkosten im Jahr 2025 dann bei etwa 55 000 EUR (Erdgas) bzw. 73 000 EUR (Heizöl). Allein der Umstieg von Heizöl extra leicht auf das etwas klimafreundlichere Erdgas würde sich also bereits nur aufgrund der höheren CO2-Abgabe amortisieren.
Nach 2025 müssen die Verschmutzungsrechte per Auktion ersteigert werden. Mit dem Wechsel der Bundesregierung und den verschärften Klimazielen ist mit weiter steigenden Preisen zu rechnen. Ob und in welcher Höhe Entlastungen (z. B. Reduzierung der EEG-Umlage) die Situation entspannen werden, ist offen.

Abschätzung der gesamten Emissionen
Auf Grundlage statistischer Daten lassen sich spezifische und absolute Mehrkosten für Brauereien unterschiedlicher Größenordnung abschätzen bzw. hochrechnen. Auf das Jahr 2019 bezogen (2020 und 2021 waren Ausnahmejahre), produzierten gut 1550 deutsche Brauereien etwas mehr als 86 Mio hl Bier. Fast 75 Prozent der Bierproduktion entfallen dabei auf Brauereien mit einem Jahresausstoß > 500 000 hl. Insgesamt werden ca. 2,2 TWh/a an Wärme und 1,0 TWh/a an Strom benötigt. Nimmt man vereinfachend an, dass alle Betriebe mit Erdgas versorgt werden und für den verbrauchten Strom der deutsche Strommix gilt (0,408 t CO2/MWh 2019), ergibt sich für deutsche Brauereien damit ein CO2-Ausstoß in Höhe von ca. 445 000 t/a (Erdgas) bzw. 413 000 t/a (Strom). In Summe liegt der Ausstoß an CO2 damit bei über 850 000 t/a. Hinzu kommen noch Emissionen durch Kältemittelverluste und Kraftstoffverbräuche. Vor- und nachgelagerte Prozesse sind in dieser Abschätzung nicht berücksichtigt.

Brauerei-spezifische Mehrkosten
Teilt man nun die Braubetriebe in unterschiedliche Ausstoßklassen ein und setzt statistische Bedarfswerte für die einzelnen Betriebsgrößen ein, so ergeben sich Kurven, anhand derer sowohl die spezifischen als auch die absoluten Mehrkosten durch CO2-Bepreisung für den eigenen Betrieb in den Jahren 2021 und 2025 abgeschätzt werden können. Es fällt auf: je höher die Produktion, desto geringer die spezifischen Mehrkosten (Abb. 1). Eine Brauerei mit einem Jahresausstoß von ca. 10 000 hl/a muss im Jahr 2025 mit ca. 75 ct/hl an Mehrkosten rechnen, eine Brauerei mit 1 Mio hl/a muss nur mit 23 ct/hl kalkulieren. Absolut betrachtet bezahlt eine Großbrauerei natürlich mehr für die CO2-Emissionen, aber auch hier flacht die Kurve entsprechend ab (Abb. 2). Der Betrieb mit 10 000 hl/a muss mit einem hohen vierstelligen Betrag rechnen, die Großbrauerei (1 Mio hl/a) mit mehr als 200 000 EUR/a.
CO2-Footprint
Nicht nur die Mehrkosten durch CO2-Bepreisung sind relevant. Das Ziel sollte ja langfristig das Erreichen der Klimaneutralität sein. Wichtig ist es also, die eigenen Energieverbräuche langfristig zu senken. Hierzu muss man zuerst den Ist-Zustand des eigenen Betriebes kennen. CO2-Footprints sind hierfür ein geeignetes Werkzeug. Anhand von national und international anerkannten Standards lässt sich der eigene Klimafußabdruck ermitteln – sowohl als absoluter Wert als auch spezifisch (z. B. in kg CO2/hl).

Weltweit anerkannte Standards sind z. B. die DIN EN ISO 14064 oder das Greenhouse Gas Protocol, das vom World Resources Institute und dem World Business Council for Sustainable Development entwickelt wurde. Der Umfang der zu beurteilenden Emissionen wird dort in drei Kategorien eingeteilt – Scope 1 bis 3 (Abb. 3).
Scope 1 beinhaltet dabei alle Emissionen, die im Unternehmen selbst entstehen. Im Wesentlichen sind dies Emissionen durch das Verbrennen von Brennstoffen und Kraftstoffen sowie Kältemittelverluste. In Scope 2 werden dann zusätzlich auch noch betriebsexterne Emissionen durch Energieumwandlung mitbetrachtet, also etwa zugekauften Fremdstrom oder Bezug von Fernwärme. Scope 3 bezieht die komplette vor- und nachgelagerte Wertschöpfungskette in die Gesamtbetrachtung mit ein. Scope 1 und 2 müssen bei einer Bilanzierung nach offizieller Norm in jedem Fall enthalten sein. Dies wird beispielsweise auch bei Zertifizierungen vorausgesetzt. Scope 3 wird auf freiwilliger Basis durchgeführt, wobei eine Komplettbetrachtung extrem aufwändig sein kann. Sinnvoll kann es aber durchaus sein, bestimmte Bereiche, die für den Betrieb relevant sind, genauer untersuchen zu lassen.
Fördermöglichkeiten
Ausgehend von dem ermittelten Ist-Zustand sollte ein Maßnahmenplan entwickelt werden, der mittel- und langfristige Ziele benennt. In vielen Fällen erscheint dafür die Zuhilfenahme eines oder mehrerer externer Experten sinnvoll. Für solche Energieberatungen zur kurz- und mittelfristigen Energieeinsparung gibt es beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) die Möglichkeit einer Förderung in Höhe von 80 Prozent (aber maximal 6000 EUR).
Im November 2021 wurde vom selben Fördergeber ein zusätzliches Programm aufgelegt, das Transformationskonzepte fördert, also strategische Konzepte, die den Weg eines Unternehmens hin zur Klimaneutralität aufzeigen sollen. Dabei werden die Betriebe bei der Planung und Umsetzung der eigenen Transformation hin zur Treibhausgasneutralität unterstützt.

Vom Konzept zum Maßnahmenplan
Im Rahmen des Konzeptes muss ein CO2-Footprint erstellt sowie der energetische Ist-Zustand detailliert ermittelt werden. Anschließend wird ein konkretes Ziel zur Reduktion der Treibhausgase (THG) um mindestens 40 Prozent für einen 10-Jahres-Zeitraum definiert. Ebenso Bestandteil des Konzeptes ist die Formulierung eines THG-Neutralitätsziels bis (spätestens) 2045. Auf dieser Basis wird dann ein Maßnahmenplan für die Zielerreichung bzw. Transformation vom Ist- zum Soll-Zustand entwickelt.
Die Detailausarbeitung von mindestens einer konkreten Maßnahme im Rahmen eines Energieeinsparkonzeptes ist genauso Bestandteil des Konzeptes wie die Verankerung des Transformationskonzeptes in der Unternehmensstruktur. Zusätzlich können auch weitere Punkte betrachtet werden, wie z. B. eine Bewertung von Chancen und Risiken oder eine Gegenüberstellung alternativer Handlungsoptionen.
Förderfähig sind dabei nicht nur anfallende Energieberatungskosten, sondern auch Kosten für Rechts- und Finanzierungsberatungen sowie weitere notwendige Dienstleistungen. Auch Messungen und Datenerhebungen können gefördert werden. Die Förderquote für Transformationskonzepte liegt für Kleine und Mittlere Unternehmen (KMU) bei 60 Prozent, für Nicht-KMU bei 50 Prozent und reicht bis zu einem maximalen Förderbetrag von 80 000 EUR.
Der Weg zur Klimaneutralität
Eine Langzeitstrategie sollte als roter Faden dienen, an dem sich der Betrieb über den anvisierten Umsetzungszeitraum orientiert. Grundsätzlich sollten zunächst vorhandene Einsparpotentiale aufgedeckt und umgesetzt werden. Hiermit lassen sich vor allem Brennstoffeinsparungen erreichen.
Zu beachten ist, dass es für Investitionen in energiesparende Maßnahmen zum Teil hohe Förderzuschüsse über verschiedene Förderprogramme gibt. Oft richtet sich die Höhe der Förderung nach der erzielbaren CO2-Einsparung. Gelistete Energie-Effizienzexperten können hier sowohl bei der Auswahl des geeigneten Programms als auch bei der Berechnung der Förderhöhe unterstützend tätig sein.
Der Bezug von Fremdstrom könnte z. B. durch Eigenerzeugungsanlagen (Photovoltaik) reduziert werden. Auch eine KWK-Anlage kann den Carbon Footprint verbessern. Bei der Auswahl des Brennstoffes (zur Dampf- oder Hochdruckheißwassererzeugung) besteht die Möglichkeit, nachwachsende Rohstoffe, z. B. Holzhackschnitzel, einzusetzen. Aber auch Erdgas kann eine sinnvolle Übergangstechnologie darstellen. Der Regenerativanteil im Erdgasnetz wird durch Zumischung von Biogas, Wasserstoff oder synthetischem Methan in den nächsten Jahren kontinuierlich steigen.
Langfristig werden auf Wasserstoff basierende Technologien eine immer größere Rolle spielen. Der Zukauf von grüner Energie sollte als letzte Möglichkeit in Betracht gezogen werden, um nicht vermeidbare Emissionen zu kompensieren.
Zusammenfassung
In Zukunft ist durch verschiedene Faktoren mit zum Teil deutlichen Preissteigerungen im Bereich der Energieversorgung zu rechnen. Zusätzlich spielt die eingeführte CO2-Bepreisung fossiler Brennstoffe eine nicht unerhebliche Rolle. Um dem entgegenzuwirken und das Ziel der Treibhausgasneutralität zu erreichen, ist eine sinnvolle Langzeitstrategie für industrielle Unternehmen unerlässlich. Ausgehend von dem ermittelten Ist-Zustand (z. B. mittels CO2-Fußabdruck) können entsprechende Konzepte mit konkreten Maßnahmen entwickelt werden. Hilfestellung gibt es in Form von diversen Förderprogrammen. Neben Investitionen in energiesparende Maßnahmen können auch Transformationskonzepte hoch bezuschusst werden.
Sie möchten sich mit einem internationalen Fachpublikum über die Entwicklungen der Getränkeindustrie austauschen? Dann laden wir Sie herzlich ein, an der nächsten drinktec vom 12. bis 16. September 2022 in München teilzunehmen.
Dieser Artikel ist powered by BRAUWELT.
